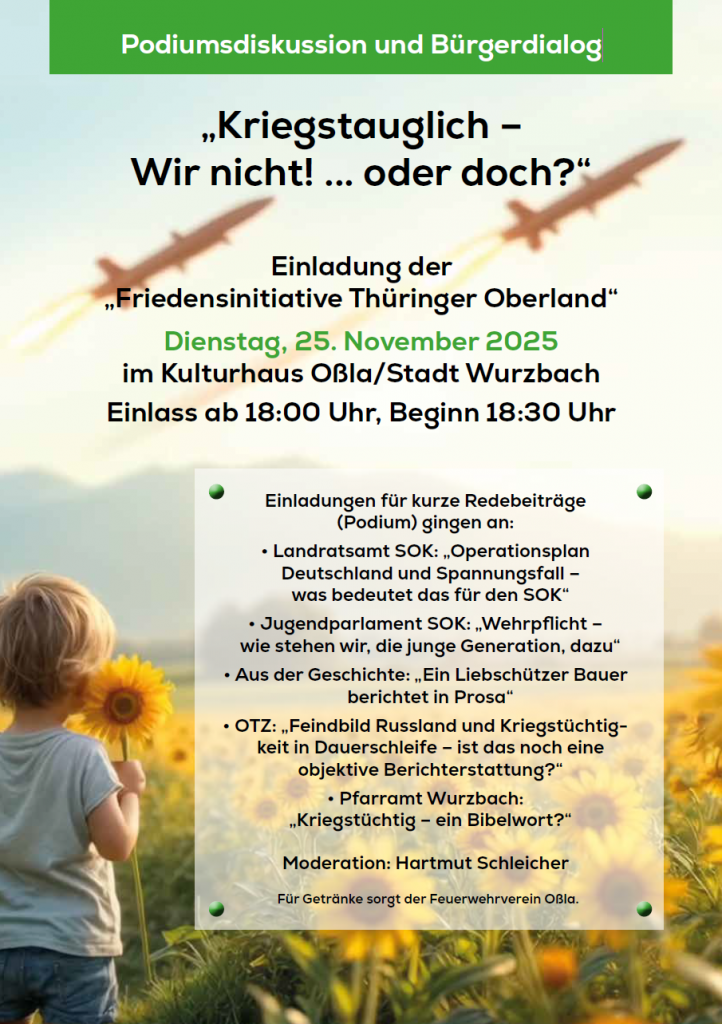Beschlussvorlage Katzenschutzverordnung SOK 02.06.25
Rede Katzenschutzverordnung Kreistag 02.06.25
Verordnung zum Schutz frei lebender Katzen – mit Änderungen Kreistag 09.09.24
Fraktion UBV/FDP/ WU
Fraktionsvorsitzender
Wolfgang Kleindienst
Kastanienallee 4a
07381 Pößneck
E-Mail: w.kleindienst@t-online.de
Tel.: 03647 423223
Rede Katzenschutzverordnung Kreistag 02.06.25
Am 26.09.22 hatte UBV den Antrag gestellt und nichts wurde unternommen. Am 09.09.24 hatte dann die Fraktion UBV/FDP/WU den Antrag erneut eingebracht.
Aufgrund des § 13b Tierschutzgesetz können Landkreise eine derartige Verordnung erlassen.
In Regionen, in der zu viele streunende Katzen herumlaufen, können Länder und Kommunen eine Kastrationspflicht einführen. Ungesicherter Freigang für fortpflanzungsfähige Katzen kann von den jeweiligen Landesregierungen verboten oder eingeschränkt werden. Im Gesetz steht außerdem, dass Katzen, die unkontrollierten freien Auslauf haben, gekennzeichnet und registriert werden müssen – etwa mit einem Mikrochip. So können Katzenhalter, die ihre fortpflanzungsfähige Katze unkontrolliert draußen herumlaufen lassen, ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden.
Die Pflicht zur Kastration der freilaufenden Katzen bzw. des Verbot des unkontrollierten Auslaufs fortpflanzungsfähiger Katzen in bestimmten Gebieten ist ein verhältnismäßiges Mittel, um Leiden, Schmerzen und Schäden der zukünftigen Katzenpopulation einzudämmen.
Eine „Katzenschutzverordnung“ ist eine lokale Verordnung in Deutschland, die darauf abzielt, das Leid freilebender Katzen zu mindern und deren unkontrollierte Vermehrung einzudämmen. Diese Verordnungen basieren auf § 13b des Tierschutzgesetzes und werden von Städten, Gemeinden oder Landkreisen erlassen.
Typische Inhalte einer Katzenschutzverordnung sind:
* Kastrationspflicht: für Katzen, die unkontrollierten Freigang haben
* Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht: Freilaufende Katzen müssen dauerhaft mittels Mikrochip oder Tätowierung gekennzeichnet und in einem Haustierregister registriert werden. Dies erleichtert die Zuordnung der Katze zu ihrem Halter im Falle des Auffindens und ermöglicht eine Unterscheidung zwischen freilebenden Streunerkatzen und Freigängerkatzen mit Halter.
* Nachweispflicht: Katzenhalter müssen in der Lage sein, auf Anfrage der zuständigen Behörde den Nachweis über Kastration und Registrierung ihrer Katzen vorzulegen.
* Maßnahmen bei Verstößen: Wenn eine fortpflanzungsfähige, unregistrierte Katze ohne Kennzeichnung gefunden wird und der Halter nicht innerhalb einer bestimmten Frist (z.B. 48 Stunden) ermittelt werden kann, kann die zuständige Behörde die Kastration auf Kosten des Halters veranlassen.
Ziele und Zweck:
* Tierschutz: Verringerung von Leid, Krankheiten und Unterernährung bei freilebenden Katzen.
* Populationskontrolle: Eindämmung der unkontrollierten Vermehrung von Streunerkatzen, die oft unter schlechten Bedingungen leben und zu Problemen in der lokalen Fauna führen können.
* Entlastung von Tierheimen: Reduzierung der Anzahl der Streunerkatzen, die von Tierheimen aufgenommen und versorgt werden müssen.
Das Grundgesetz (GG) verankert Tierschutz als Staatsziel in Artikel 20a, der besagt, dass der Staat die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung schützt. Dies bedeutet, dass der Staat die Verantwortung für den Tierschutz hat und ihn in den Gesetzestexten und in der Anwendung der Gesetze berücksichtigt.
Das TierSchG dient der Umsetzung des Staatszieles Tierschutz im GG. Es enthält konkrete Regelungen, welche Handlungen gegenüber Tieren verboten sind und welche Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen.
Das Gesetz soll das Leben und Wohlbefinden der Tiere schützen und sicherstellen, dass ihnen ohne vernünftigen Grund keine Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Tierschutzgesetz die konkreten Regeln für den Tierschutz festlegt, während Artikel 20a GG den Tierschutz als Staatsziel verankert und den Staat verpflichtet, ihn zu gewährleisten.
Mit unserem Antrag zu einer Katzenschutzverordnung und der heutigen Beschlussvorlage wollen wir auch das Staatsziel des Tierschutzes im Grundgesetz und die Festlegungen im Tierschutzgesetz nachkommen und erfüllen.
Die benannten jährlichen Kosten durch die Verwaltung i.H.v. 228 T€ stehen im Widerspruch der Erfahrungswerte anderer kreisfreien Städte und Landkreise.
So werden durch den Amtstierarzt der Stadt Erfurt Dr. Kreis jährliche Kosten von
5 T€ angegeben. Diese Erfahrung wird auch vom Bund der Katzenfreunde bestätigt.
Es entsteht der Eindruck, dass man mit der Drohgebärde der Kosten die Kreistagsmitglieder beeinflussen will.
Es geht dabei nicht um die Kastration von herrenlosen Tieren, sondern um die Pflicht der Besitzer Ihre Tiere zu kastrieren und zu registrieren!
Mit dieser Auslegung werden die Gemeinden nur verunsichert, denn natürlich will keine Gemeinde zusätzliche Kosten haben bei der finanziellen Lage der einzelnen Gemeinden!!
Viele Tierschützer und Bürger haben den Artikel der OTZ vom 31.05.25 „Katzen könnten für Pößneck und Schleiz teuer werden kritisiert.
Ich zitiere: „Dieser Artikel wäre ja wohl ein Witz und hat mit dem eigentliche Sinn der Katzenschutzverordnung wohl nichts zu tun.“
Populismus ist hier fehl am Platz und die Sorgfaltspflicht nach dem Pressegesetz wäre dringend notwendig.
Regionalverband der Kleingärtner Saale Orla – 09.04.25
Problem-Meldungen aus der KGA Einheit, KGA Frieden und KGA Wiesenburg in Triptis, KGA Wotufa und Molbitz in Neustadt/Orla und KGA Altenburg und Kirschplantage Pößneck.
Man geht davon aus, dass in 2/3 der KGA freie Katzen ihr Unwesen treiben.
Kommt es zu einer Ablehnung der Katzenschutzverordnung kann ich allen Tierfreunden nur empfehlen, sich mit den Problemen von Freigängerkatzen zukünftig an ihre Bürgermeister und Verwaltungsgemeinschaften zu wenden.
Denn laut Landrat sehen die Bürgermeister von Pößneck und Schleiz keinen Bedarf für eine Katzenschutzverordnung und werden sich dann bestimmt darum kümmern. So können wir auch die ehrenamtlichen Bürger des Tierschutzvereins und der Tierheime entlasten. Die Kosten werden dann bei den Städten und Gemeinden ansteigen. Bei einer heutigen Ablehnung der Katzenschutzverordnung wird die UBV die Ansprechpartner der Städte und Gemeinden im Saale-Orla-Kreis auf ihrer Webseite für die Bürger veröffentlichen.
Parteien, welche die Katzenschutzverordnung ablehnen, empfehle ich, den Passus „Tierschutz“ aus ihren Parteiprogrammen zu streichen, um weitere Wählertäuschungen zu vermeiden.
Ich möchte eine Stellungnahme von Frau Großmann vom Tierschutzverein Orlatal ankündigen, die laut Frau Großmann von Frau Kanis (SPD) im Anschluss verlesen wird.
Ich bitte darum meine Zustimmung zur vorliegenden Katzenschutzverordnung in die Niederschrift aufzunehmen.
Wolfgang Kleindienst